Lesegenauigkeit
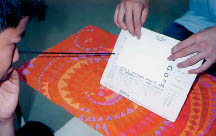 Lea Nahsehschärfetest mit gruppierten Symbolen |
Bevor ein Kind zu lesen lernt, kann die “Lesefähigkeit” abgeschätzt werden, wenn man die gruppierten Symbole und Zahlenteste verwendet. Sehschärfewerte die mit den gruppierten Symbolen gemessen werden, sind auch bei normalsichtigen Kindern, geringer als die, die mit den Reihentesten gemessen werden. Bei bestimmten sehgeschädigten Kindern, besonders bei Kindern mit Gehirnschädigungen die in Bezug zu Sehschädigungen stehen, kann diese Differenz mehrere Reihen betragen. |
Man misst die Sehschärfe mit den gruppierten Symbolen (50% und 25% Buchstabenabstand) oder mit den gruppierten Zahlen (50%, 25% und 12,5% Buchstabenabstand) in 40 cm Entfernung und in der Entfernung, die das Kind bevorzugt.
Wenn das Kind bereits lesen kann, wird das Lesen mit Texten, die der Lesefähigkeit des Kindes entsprechen, getestet.
1. Schwelle
Man misst die kleinste Textgröße, die das Kind noch in einer bequemen Entfernung lesen kann und die kleinste Größe die das Kind in einer näheren Entfernung lesen kann. Man notiert diese Textgrößen, zum Beispiel: „las 12 Punkt Text in 25 cm Entfernung was er bequem empfand; kann 8 Punkt Text in 10 cm für kurze Zeit lesen“. (Letzteres wird als „Nahsehschärfe“ oftmals in medizinischen Berichten der Kinder angezeigt.)
2. Optimale Größe
Man misst wie viel größer der Text sein muss, um ein fließendes Lesen über längere Zeit zu ermöglichen. Das ist gewöhnlich 3-10mal größer als die Schwellengröße. ( Keiner von uns liest gerne einen Text in der Schwellengröße auch wenn man den Text kennt. Sehgeschädigte Kinder sollten nicht gebeten werden, anders aufzutreten.)
Basierend auf der Messung der optimalen Textgröße kann man die Vergrößerung die das Kind zum Lesen der Texte benötigt, die in ihrem/seinen Klassenraum benutzt werden, abschätzen. Man testet die vergrößernden Sehhilfen mit dieser Vergrößerung und vergleicht sie mit denen die das Kind gegenwärtig benutzt. Wenn das Kind eine höhere Vergrößerung benötigt, als die Kalkulation ergab, kann es sein, dass das Kind mit einem anderen Netzhautort (PRL) als bei der Sehschärfenmessung schaut (zum Beispiel, wenn die zentrale Insel des Sehens so klein ist, dass einzelne Symbole gesehen werden aber der Text nicht gut hineinpasst, kann das Kind einen anderen Netzhautort wählen, welcher eine geringere Schärfe bietet, jedoch ein größeres Sehfeld).
3. Lesegeschwindigkeit
Man misst wie viele Wörter das Kind pro Minute (WPM) von einem dem Alter entsprechenden Standardtext in optimaler Größe liest und wie viele bei Texten die der Lehrer des Kindes verwendet. Man ermittelt die Buchstaben und die Anzahl der Lesefehler die er/sie macht.
4. Leseverständnis
Man bereitet zuvor ein paar Fragen über den Inhalt der Passage vor, die das Kind lesen wird und schreibt die wichtigen Teile der Antworten auf, um die Fähigkeit des Kindes den Text beim ersten Lesen zu verstehen, festzuhalten. Wenn das Kind all seine Energie zum Lesen benötigt und sich daher nicht mehr an den Inhalt erinnern kann, erlaubt man ein zweites Lesen der Passage.
Winzige Ausfälle des zentralen Gesichtsfeldes können das Lesen stören, so dass ein Leseanfänger als dyslektisch diagnostiziert werden kann, obwohl die Lesefehler durch den Verlust der visuellen Information auf eine Schädigung der vorderen Sehbahnen zurückzuführen sind. Wenn, zum Beispiel, ein solches Gebiet des Sehverlustes, ein Skotom, rechts vom Fixationspunkt liegt, so dass der vierte Buchstabe in jedem Wort in einem Text bestimmter Größe verschwindet, hat das Kind eine „ungewöhnliche Art der Leseschwierigkeit“. Diese Fehler verändern ihren relativen Platz bei kleineren Texten zum Ende der Wörter hin und bei größeren Texten zum Anfang des Wortes. Die Fehler verschwinden, wenn die Buchstaben so groß sind, dass nur noch ein Teil des Buchstaben unsichtbar ist. Diese regelmäßigen „ungewöhnlichen“ Fehler beim Lesen sollten vom Tester beachtet werden.
Wenn das bevorzugte Netzhautgebiet oberhalb des zentralen Skotoms liegt, nutzt die Planung der Augenbewegungen entweder dieses neue bevorzugte Netzhautareal oder die anatomische Fovea als Zentrum, in Relation dazu, wohin die Koordinaten der Augenbewegungen entschlossen sind. In beiden Fällen gibt es oft Unregelmäßigkeiten bei den schnellen Augenbewegungen, den Sakkaden, mit Korrektionsbewegungen in beide Richtungen horizontal und vertikal. Dies kann man am besten sehen, wenn man die Augenbewegungen aufzeichnet oder indem man die Augenbewegungen mit dem sehr teuren Scanning Laser Ophthalmoskop (SLO) beobachtet, jedoch können sie auch mit Hilfe einer preiswerten Technik beobachtet werden: man benutzt einen dem Alter entsprechenden Text als durchsichtige Kopie (Overheadfolie) durch welche man die Augenbewegungen des Kindes während des Lesens sehen kann. Man sollte sicherstellen, dass man weiße oder helle, gleichmäßig gefärbte Kleidung als Hintergrund des Textes trägt (eine lange weisse Schürze). Wenn die Sakkaden unregelmäßig sind, ist es oft notwendig, die Lesetechnik zu verändern, so dass das Kind den Kopf und die Augen ruhig hält und stattdessen der Text bewegt wird. Wenn das Kind größere Schwierigkeiten hat, die Fixation zu halten, kann der Text Wort für Wort immer an der gleichen Stelle eines Computerbildschirms (wo Computer vorhanden sind) erscheinend, gezeigt werden um alle okulomotorischen Anforderungen zu vermeiden. Das Kind benutzt die Pfeiltasten, um sich im Text vorwärts oder rückwärts zu bewegen.
Schließlich befragt man das Kind über Verzerrungen von geraden Linien und über unscharfe Buchstaben oder das Verschwinden von einigen Buchstaben. Das veranschaulicht weiter die Qualität des zentralen Gesichtsfeldes zum Lesen. Abhängig von der Qualität des zentralen Gesichtsfeldes und der Qualität der okulomotorischen Funktionen kann man eine andere Technik für das Lesen vorschlagen. Später, wenn die Anforderungen beim Lesen steigen, kann man die verwendete Vergrößerung erneut prüfen und die Art der vergrößernden Sehhilfe oder die Beleuchtung verändern.