Sehen im Kindesalter
Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik
Ein Festvortrag am 30. Januar 2002 in Dortmund

Zunächst möchte ich der Universität Dortmund ganz herzlich für Ihre Einladung im Rahmen des Gambrinus Fellowship Programms danken. Nach vierzig Jahren im angloamerikanischen Kulturkreis ist es erfrischend, wieder einmal eine längere Zeit in einer deutschsprachigen Universitätsumgebung in meinem liebsten Arbeitsgebiet, der pädiatrischen Rehabilitation und Frühbetreuung, zusammen mit guten Freunden zu arbeiten.
Wenn wir die Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik in der pädiatrischen Augenheilkunde beschreiben wollen, müssen wir zuerst einige Begriffe klären, wie eine Landkarte in großen Zügen zeichnen, um unseren Weg durch die langen und komplizierten Bahnen des visuellen Systems zu finden.
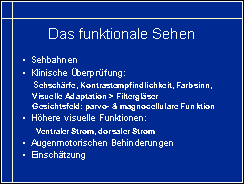
Eine Diagnose des kindlichen Sehens, die eine Bedeutung für den Alltag hat, erfordert heute viele Testverfahren und Beobachtungen. Das Kind darf nicht nur im klinischen Zusammenhang sondern sollte bei sehr unterschiedlichen Alltagsaktivitäten beobachtet werden.
Für meinen heutigen Vortrag habe ich das funktionelle Sehen mit den folgenden Themen gewählt: Ich werde Ihnen zunächst etwas
- über die Funktion der Sehbahnen erzählen,
- dann etwas zur klinischen Überprüfung sagen
- in einem dritten Teil werde ich mich auf die sogenannten höheren visuellen Funktionen beziehen,
- schließlich auf die oculomotorischen Einschränkungen und - abschließend diejenigen Faktoren benennen, die für eine zusammenfassende Einschätzung erforderlich sind.
Bei der Untersuchung des Sehens beschränkt man sich zu oft auf die Schädigungen des Auges und der vorderen Sehbahnen. Sehen ist jedoch viel mehr, es ist eine Funktion des Gehirns und deshalb müssen alle informationsverarbeitenden Bereiche einbezogen werden.
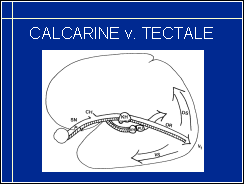
Die Sehbahnen leiten die visuellen Informationen von der Netzhaut zum lateralen Kniehöcker (KH) und von dort zu der visuellen Hirnrinde im calcarinen Cortex, wo die primäre kortikale Verarbeitung, die ‚Bildanalyse' beginnt um sich dann in mehr als 30 spezifischen Gehirnrinden -arealen fortzusetzen. Die Informationen breiten sich in zwei Hauptrichtungen aus, aufwärts zur parietalen Gehirnrinde - das ist der so genannte dorsale Strom und abwärts zum niedrigen Teil der Temporallappen - der ventrale Strom.
Gleichzeitig wird ein Teil der visuellen Information durch die so genannten tectalen Bahnen direkt zur parietalen Hirnrinde überführt, allerdings ohne Bildanalyse, stattdessen aber mit einer hohen Effektivität des Bewegungssehens.
Sie können das Bewegungssehen selbst ausprobieren, wenn sie die Hand schnell vor Ihrem Gesicht hin und herbewegen, ohne die Hand mit den Augen zu verfolgen. Sie erkennen eine Hand, aber sie erkennen keine Details und wenn die Bewegung endet, bleibt kein visuelles Bild erhalten.
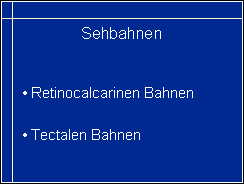
Die zwei Hauptbahnen zwischen Netzhaut und Gehirnrinde sind also die retinocalcarinen und die tectalen Bahnen. Die retinocalcarinen Bahnen führen die Informationen von der Gangliozellen der Netzhaut bis zum der primären Sehrinde und die tectalen Bahnen zum Vierhügel und davon zu okulomotorischen Kernen, andere subkortikale Zellgruppen und via Pulvinar zu der Gehirnrinde.
In beiden Bahnen gibt es verschiedene Nervenfasern, die hier mit den Buchstaben P und M bezeichnet sind: Dies sind die parvo- und magnozellularen Fasern:
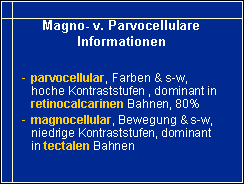
Dünne parvozellulare Fasern leiten alle Farbinformationen und die schwarzweißen Informationen bei hohem Kontrast weiter. Dicke, magnozellulare Fasern, übermitteln die Bewegungsinformation und schwarzweiße Informationen bei niedrigem Kontrast. Der Aufbau der Sehbahnen mit mehreren spezifischen Nervenfasergruppen und mehreren spezifischen analytischen Funktionen in der Hirnrinde und in subkortikalen Zentren, ist die Ursache der Mannigfaltigkeit der Sehschädigungen.
Die Information in den zwei wichtigsten Fasertypen beschreibt man auf Englisch als sustained, andauernd, langsam sich ändernd und transient, vorübergehend, flüchtig. Den Unterschied zwischen diesen Informationen werde ich Ihnen mit den folgenden Dias erklären.

Sie sehen hier eine kleine graue Fläche. Sehen Sie nicht diese Fläche, sondern das Stoppzeichen an. Wenn Sie dies tun, verschwindet nach etwa 5 Sekunden die graue Fläche aus Ihrem Gesichtsfeld, obwohl sie eigentlich noch da ist.
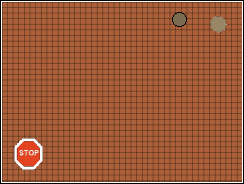
Jetzt sehen Sie eine andere graue Fläche, aber mit Flicker, also einer transienten, flüchtigen Information. Sehen Sie wieder auf das Stoppzeichen. Sie werden merken, dass die flackernde Fläche nicht verschwindet, sondern sogar die nicht-flackernde Fläche dann und wann auftaucht. Die transiente, vorübergehende Information erleichtert die Wahrnehmung der andauernden Information.
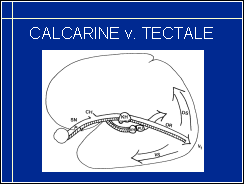
Nach dieser kurzen Einführung in die Anatomie und Physiologie der Sehbahnen, möchte ich etwas über die Möglichkeit der Diagnostik des Sehens bei Kindern sagen. Wie es in der traditionellen Ophthalmologie üblich ist, beginnen wir bei der Überprüfung der Sehschädigungen mit den vorderen Teilen der Sehbahnen, zu denen auch die Augen gehören.
Was meinen wir mit Sehschädigungen? In der Augenheilkunde benutzen wir gewöhnlich das Formsehen als der Maßstab für den Grad der Sehschädigung und messen das Formsehen als Sehschärfe.
Wenn wir aber das funktionelle Sehen, die Natur des spezifischen Bildes und vor allem die Struktur der visuellen Welt des Kindes untersuchen und verstehen wollen, müssen wir uns fragen, ob und in welcher Weise Sehschärfewerte geeignet sind, das veränderte Sehen adäquat zu beschreiben?
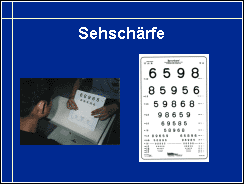
Die Distanzsehschärfe bei hohen Kontraststufen ist sicher der am häufigsten gemessene Wert in allen Augenkliniken. Doch diese Überprüfung reicht bei weitem nicht aus, vielmehr sollte sie durch mindestens fünf weitere Testverfahren ergänzt werden.
Zunächst sollte die Sehschärfe der Kinder nicht nur als Distanzsehschärfe sondern auch als Nahsehschärfe gemessen werden.
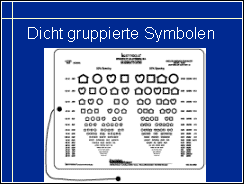
Ist ein Kind alt genug so wird die Nahsehschärfe mit dicht gruppierten Symbolen gemessen.
Hohe Sehschärfewerte gelten allgemein als Zeichen für ein gutes Sehvermögen. Doch nur ein sehr kleiner Teil der visuellen Informationen wird im Bereich der hohen Sehschärfewerte durch die Sehbahnen weitergeleitet. Ich werde dies mit den nächsten Bildern verdeutlichen.
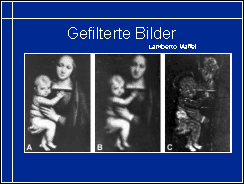
Diese drei Photos, das originale auf der linken Seite und die zwei gefilterten Fotos von Professor Lamberto Maffei, der freundlicherweise diese Bilder für mich 1981 gemacht hat, demonstrieren die Struktur der visuellen Informationen: Im mittleren Bild sind nur Linien, die eine Sehschärfe von weniger als 0.15 entsprechen und im Bild auf der rechten Seite sind nur Linien, die eine Sehschärfe besser als 0.3 entsprechen. Wir sehen, dass funktionell die mittleren Linienbreiten, die niedrigeren Sehschärfewerte, welche die runden Formen und die niedrigen Kontraste enthalten, mehr Informationen enthalten als die feinen Linien, die nur Einzelheiten hinzufügen.
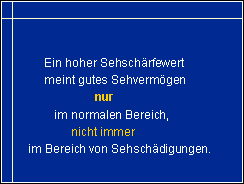
Dieses Beispiel macht deutlich: Ein hoher Sehschärfewert meint gutes Sehvermögen nur im normalen Bereich, nicht immer im Bereich von Sehschädigungen. Hat man, wie nach Entzündung des Sehnervs, Funktionen im Bereich der niedrigen Kontraste verloren, so kann die Sehschärfe nahezu normal sein, aber dass Bild ist flach, die runden Formen kann man nicht mehr sehen. Im Gegenteil zu dem Vorigen kann eine kleine Makuladegeneration das foveale Sehen, und damit die hohen Sehschärfewerte verändern, ohne die Funktionen in der naheliegenden Netzhaut zu stören. Dadurch ist das Sehen bei niedrigen Kontraststufen und niedrigeren Sehschärfewerten normal. Die runden Formen kann man sehen, Lesen aber erfordert vergrößernde Sehhilfen.
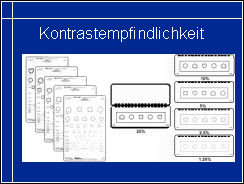
Da wir Formen auch bei niedrigen Kontraststufen sehen, sollen wir sie als ein Teil der klinischen Untersuchung gebrauchen. Die Funktion bei niedrigen Kontraststufen messen wir am einfachsten mit Sehschärfetafeln mit niedrigem Kontrast. Wenn wir die Sehschärfe bei 2.5% und 1% Kontrast oder mit diesen neuen Tafeln messen, erhalten wir die Kontrastempfindlichkeitskurve, welche die Weiterleitungskapazität der schwarz-weißen Forminformation in den Sehbahnen beschreibt.
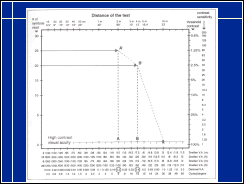
Auf den hohen Kontraststufen des Diagrams sind die Sehschärfewerte dargestellt. Sie sehen hier, die Sehschärfe wird besser in der Richtung nach rechts. Die Kontrastempfindlichkeit wird besser in der Richtung der Y-Achse. Jenseits der Kurve sind die schwachen Kontraste, die wir nicht sehen, und rechts die zu feinen Linien. - Innerhalb dieser Kurve sind die Formen, die wir sehen können. Wir sehen hier auch, dass das Sehsystem sehr viel empfindlicher im Bereich der Sehschärfe von 0.15 ist als im Bereich der Sehschärfewerte besser als 0.3. Dies bedeutet:
Bei der Überprüfung des funktionellen Sehens sollten wir die Sehschärfe sowohl auf hohem als auch auf niedrigem Kontrastniveau messen.

Wenn wir Gittersehschärfe und Gesichtsbilder bei niedrigem Kontrast, wie die Hiding Heidi Bilder benutzen, können wir beide Messungen schon im Alter von einigen Wochen machen, wie wir in der nächsten kurzen Videosequenz sehen:
Zuerst werden Sie die Gittersehschärfemessung sehen: man zeigt dem Kinde eine Fläche mit Gittermuster und eine andere graue Fläche. Wenn das Kind die gerasterte Fläche sieht, schaut es sie an. In gleicher Weise benutzt man den Hiding Heidi Test. Man beobachtet also, ob das Kind auf die gerasterte Fläche, beziehungsweise auf das Heidi-Bild schaut, wie es mit dem Kleinkind in der Videosequenz der Fall ist. Würde das Kind keinen Unterschied sehen, so würde es nicht auf den Stimulus reagieren.
Wir können also festhalten, bei der Untersuchung des Formsehens sollte mehr als nur die Sehschärfe auf hohem Kontrastniveau überprüft werden.
Die zwei anderen Komponenten des Bildes,
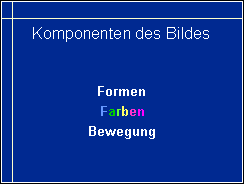
die Farben und die Bewegung werden klinisch noch weniger untersucht.
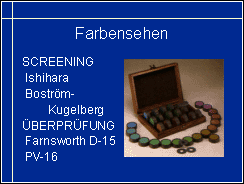
Farben spielen eine wichtige Rolle im Sehen. Sie sind leichter und schneller als Formen zu erkennen und werden darum als Warnzeichen benutzt.
Bei Vorliegen einer Sehschädigung sollte man bei der Diagnostik des Farbensehens keine Screening- Verfahren anwenden, sondern auf quantitative Testverfahren zurückgreifen.
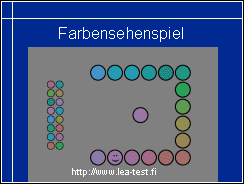
Das Farbensehen können wir spielerisch schon im Alter von zwei Jahren untersuchen und
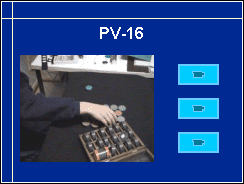
ein volles Testverfahren ist im Alter von fünf Jahren auch bei den tauben Kindern möglich. Dieser Junge, der Usher Syndrom hat, hatte dem Testverfahren einmal zugeschaut, als ein älterer Junge den Test ausführte. Sie sehen, der Junge ist beinahe so schnell wie ein Erwachsener.
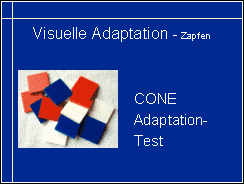
Die nächste wichtige zu untersuchende Funktion ist die visuelle Adaptation, die wir als die Adaptationszeit der Zapfenzellen in einer Spielsituation schnell messen können.
Sie ist bei vielen täglichen Aktivitäten wichtig. Wir können die Adaptationsfähigkeit der Zapfen nachvollziehen, wenn wir in einen Kleiderschrank oder unter einen Tisch gucken, wo das Beleuchtungsniveau niedriger ist als im übrigen Raum. Wir brauchen einige Sekunden, um zu beginnen klar zu sehen.

Wie Sie wissen, benutzen wir Zapfensehen im Tageslicht und Stäbchensehen im Dunkeln. Wenn das Niveau der Beleuchtung zunimmt, hemmt die Zapfenfunktion die der Stäbchen. Ist aber zum Beispiel die Anzahl der Zapfen aufgrund einer Netzhautdegeneration gering, so hemmt die Zapfenfunktion die der Stäbchen im Tageslicht nicht und die sehr lichtempfindlichen Stäbchen werden hyperaktiv, mit dem Resultat, dass die Person geblendet wird.
Da die Absorptionskurve der Stäbchen, diese schwarze Linie, und die der drei Zapfenpopulationen ihr Maximum in verschiedenen Teilen des Spektrums haben, ist es möglich die Aktivität der Stäbchen im Tageslicht so zu vermindern, dass man die Komposition des Lichtes mit spezifischen Filtergläsern ändert.
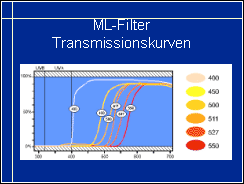
Als ein Beispiel sehen wir hier die Absorptionskurven der sogenannten Multilens- Filter. Sie absorbieren das blaue und blaugrüne Licht und dadurch - so erkläre ich es gewöhnlich den Kindern - "glauben die Stäbchen, dass es Abend ist und funktionieren normal, - weil aber die Zapfen wissen, dass es Tag ist, funktionieren sie auch normal". Auf diese Weise sind Millionen Stäbchen gleichzeitig mit den Zapfen aktiv, was wir als ein vermehrtes Beleuchtungsniveau wahrnehmen, obwohl weniger Licht auf die Augen trifft. Da Filter bei vielen Netzhautveränderungen die Qualität des Bildes verbessern, sollten sie öfter und besser als heute überprüft und eingesetzt werden.